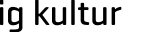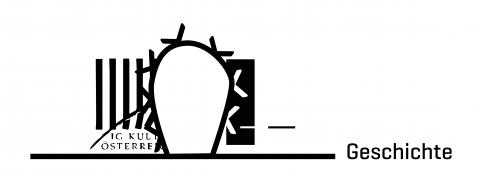Bedenkjahr 2008
Das Ereignis im 20. Jahrhundert, meint Hayden White, ist stets ein mediales Ereignis. Es adressiert uns als Publikum und es unterliegt mehr der Ordnung der Ästhetik, denn jener der Politik.
Historische Erfahrungen, sagte Walter Benjamin, müssen sich in ein Sprichwort pressen lassen. Andernfalls bleiben die Ereignisse Erlebnisse, das heißt: folgenlos (als Handlungsorientierung). Irgendwann – manche meinen nicht grundlos während des Großen Krieges 1914/18 – ist diese Fertigkeit, die Vergangenheit in epigrammatische Geschichten überzuführen, die allen gehören, verloren gegangen. An deren Stelle ist ein unendliches Archiv visueller und akustischer Monumente getreten, das seine affektiven und performativen Dimensionen hervorkehrt. Das Dritte Reich beeindruckt dann, wenn es in Farbe (seit 1998 auf Spiegel-TV) kommt, der Mai´68, wenn Street Fighting Man brennenden Autos unterlegt wird. Die technischen Aufzeichnungsapparaturen, die dieses Archiv bilden, Agenturfotografie, Film, Magnetband und andere, haben die vermittelnde Rede über das Geschehene ersetzt und filtern schon im Moment ihrer Tätigkeit aus, was die künftige Vergangenheit bilden kann. Das Ereignis im 20. Jahrhundert, meint deshalb Hayden White, ist stets ein mediales Ereignis. Es adressiert uns als Publikum und es unterliegt mehr der Ordnung der Ästhetik, denn jener der Politik.
Konventionen
Die Proklamation von „Bedenkjahren“, wie es 2008 in Österreich passiert, könnte zunächst als vernünftiges Vorhaben betrachtet werden, reflexiv inne zu halten und zu sondieren, was zum Minimum an offizieller Geschichte zu zählen wäre. Ein solches Verfahren aber müsste zu aller erst bekräftigen, dass es auf kulturelle Artefakte Bezug nimmt, auf die zuvor genannten Archive ebenso, wie auf die Poetiken der HistorikerInnen. 1848 – 1918 – 1938 – 1968, die Stationen des heurigen Bedenkjahres: Für sich, da ist den Kritikern des „Zwangs der runden Zahl“ als Anstoß des Rückblickens zuzustimmen, besagen die Daten wenig. Sie gewinnen Bedeutung erst in der Rahmung durch Narrative, durch kulturelle Konventionen. Und diese sind, bezogen auf die Gedenkdaten 2008, so divers, wie ihre Konstruktionsregeln von der Zukunftserwartung der jeweiligen ErzählerInnen abhängig sind.
Epiphänomen Revolte
Ein Leben mit dem Wissen um den fiktionalen und ästhetischen Charakter aller Geschichte – das verträgt sich kaum mit der Legitimation, die eine offizielle Politik des historischen Bedenkens benötigt. Denn hier geht es nochmals um die Verteilung von Schuld und Verdiensten, die auf der Annahme eines kausalen Verlaufs von Geschichte beruhen, den es nachträglich abzubilden und dessen momentanes Ende, es zu rechtfertigen gilt. Zum Beispiel die Revolutionen: 1848. 1918. 1968. Wo sollen sie hin, außerhalb eines Denkens in Ursachen und Wirkungen, wie es eine staatsorientierte Erinnerungspolitik verlangt? Was lässt sich mit der Vorstellung anfangen, dass Revolten und Verweigerungen periodisch ausbrechen und wie Foucault es einmal ausgedrückt hat, mehr dem untilgbaren Willen zur Veränderung, als den herrschenden Umständen zugerechnet werden müssen? Was tut man mit den widersprüchlichen Bewegungen, Manifesten und Praktiken, die in ihnen zutage treten? Nun, sie werden in großen Erzählungen zu a-rationalen Epiphänomenen eines – hinter dem Rücken der Akteure ablaufenden – Prozesses, dem sie bestens noch als Katalysatoren dienen. An dessen Ende steht die Vernunft der geschmeidig sich wandelnden Institutionen. Eine der originellsten Interpretationen des Jahres 1848 geht denn auch dahin, dass die Revolution der Zivilgesellschaft gegen den Staat, repräsentiert in Handelskammern und Vereinen, rascher zum Durchbruch verholfen hat. Also: Die Revolution ist akzidentiell und brauchbar davon sind die Elemente, die zu bürgerlichen Institutionen gewandelt werden können. Und 1968, wenn es überhaupt eine Revolution gewesen sein soll? Die Studentenrebellion, so eine andere Meinung, implodierte erfolgreich, um einer Politik der angemessenen Reformen freie Bahn zu geben. Oder sollte sie etwa doch nur dafür da gewesen sein, wie Dritte meinen, um der jugendinspirierten Konsumgesellschaft Tür und Tor zu öffnen? 1918: Zerfall der Monarchie, Untergang der „Welt von gestern“, wie Stefan Zweig schrieb oder revolutionärer Neubeginn – beides ist möglich, in HistorikerInnentexten wie in TV-Dokus, Trauer um den Zerfall der imperialen Größe, der man sich als (deutschsprechender) „Österreicher“ zurechnen durfte oder demokratische Emphase? (Im neu-europäischen Kontext nach 1989 wird man indes erwarten dürfen, dass es nur ein schmerzlicher Um- und Läuterungsweg zur Wiedervereinigung der nunmehr zu „Vaterländern“ gewordenen Habsburger-Provinzen gewesen ist.) Vor allem aber geht es um einen Vorwurf, der – Begründung ex negativo – durch die Jahrzehnte bis heute das Regulativ österreichischer Politik ausmacht: Der fehlende Konsens der Eliten und ein „überzogener“ Parlamentarismus ziehen die Anarchie und die Katastrophe nach sich. Und dann 1938: War der „Anschluss“ die logische Folge des Hasses auf den Austrofaschismus oder umgekehrt ein paradoxer „Erfolg“ der Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur, die den Nationalsozialisten keine andere Möglichkeit ließ, als mit militärischer Gewalt Österreich zu okkupieren? Anders gesagt: Rechtfertigt die Erhabenheit des Patriotismus die kleinen wie die großen Verfassungsbrüche, wie uns die kürzlich überraschende österreichische „Präventivkriegsthese“ zur Rechtfertigung der Staatsstreiche 1933 und 1934 nahe legt?
Materialismus
Die Auflösung von sprichwortgerechten Erfahrungen in modernistische Ereignisse kann nicht nur als Verlust gesehen werden. Sie bedeutet auch einen Zugewinn, eine Entlastung von der strengen Verbindlichkeit, die Geschichte als autoritative Nationalgeschichte – und mehr ist sie in ihrer öffentlichen Form bislang noch nicht geworden – mit sich bringt. Die Vorstellung einer „materialistischen“ Geschichte schließt hier an, am Überschuss an Bedeutungen den Bilder, Töne, Architekturen, aber selbstverständlich auch subjektive Erzählungen bieten, am Anstoß den sie geben, die Vergangenheit auf die verborgenen Möglichkeiten zu befragen, die von spezifischen Machtkonstellationen faktisch und in der historischen Rekonstruktion nochmals durch den ideologischen Apparat getilgt worden sind. Das ominöse „kulturelle Gedächtnis“, wo es nicht missverstanden und als Illustrierung historiografischer Thesen verkauft wird, sondern als bewusste, keinen Diskursformationen unterworfene ästhetische Formsetzung, ist das produktive Terrain, auf dem dieser Materialismus sich bewegt.1
Vergangenheitspolitik
Könnte man sich also ein „Bedenkjahr“ vorstellen als Versammlung dieser, ähnlicher, und noch zu schaffender Projekte, die zugleich mit den Geschichten, die sie erzählen, die Frage nach den ästhetischen Voraussetzungen des Erinnerns, nach dem Fragmentarischen und Konstruktiven des Gedächtnisses aktualisieren? Indes: Das Bedenkjahr 2008 setzt auf dem seit Mitte der 90er Jahre laufenden Trend auf, die ermattete und reichlich labyrinthische österreichische Geschichte durch eine aktive, institutionell gesteuerte „Vergangenheitspolitik“ zu ersetzen. Dabei rückt der „Anschluss“ 1938, das Kürzel für die Verstrickungen in die nationalsozialistischen Verbrechen, zum Grund von Geschichte überhaupt auf. Alle andere Vergangenheit ist entweder Vor- oder Nachgeschichte, steht entweder im Zeichen der (gescheiterten) Bannung dieses Ereignisses oder seiner Korrektur. Dies zumindest ist die Botschaft, die sich in der Argumentationsgrundlage des österreichischen Außenministeriums aus Anlass der Sanktionen der Europäischen Union gegen die Regierungsbeteiligung der FPÖ ausdrückt. Dem Vorwurf, Österreich pflege einen opportunistischen Umgang mit seiner Vergangenheit, wird hier mit der begrifflichen Gleichsetzung von „Vergangenheit“ und Nationalsozialismus begegnet, „Geschichte“ kondensiert als Einbruch einer beinahe tellurischen Macht in eine Pastorale. Die Monumentalisierung, die damit erfolgt, neutralisiert Bewegungen, Dynamiken, Subjektivitäten, Lebensentwürfe. „Österreich hat in den Jahren vor 1938 mit den Mitteln eines autoritären Staates letztlich erfolglos gegen das Aufkommen des Nationalsozialismus auch im eigenen Land gekämpft. Unter Dollfuß und Schuschnigg waren die NSDAP, aber auch (aus anderen Gründen) die Sozialdemokratische Partei verboten. (Über diese „anderen“ Gründe wird nichts berichtet, aber offenkundig ist in dieser Formulierung, dass die 40% sozialdemokratischen Wähler keine Österreicher waren.) Die Abwehr des Nationalsozialismus und die Erhaltung der Unabhängigkeit Österreichs waren zentrale Ziele der Regierung, die mit der für 13. März 1938 geplanten Volksabstimmung ein für alle mal verwirklicht werden sollten. Hitler kam dieser Entscheidung mit dem Einmarsch zuvor, da er eine Niederlage fürchtete. Die Beteiligung österreichischer Staatsbürger an den NS-Verbrechen wird nicht geleugnet, aber was nach 1945 als politisches und moralisches Problem zu verhandeln gewesen wäre, was unter Umständen zur Neukonzeption von Rechtssystemen und zur Revision von Herrschafts- und Machtsystemen hätte führen können (oder von manchen gewünscht war), wird in dieser Argumentation als ökonomische Restitution angetragen. Opferhilfsfonds, Zwangsarbeiterentschädigung, Rückstellung „arisierten“ Eigentums. Die Verwandlung von Schuld in Schulden hat man das in der BRD einmal genannt; als Zugabe ein Haus der Geschichte. Und eine verblüffende Lehre: „Das Vorhaben der Europäischen Union“, heißt es weiter, „eines breiten, demokratischen und wohlhabenden Europas, ist die beste Garantie gegen eine Wiederkehr dieses dunkelsten Kapitels der österreichischen Geschichte.“ Welches Außenministerium hat der Verfasstheit der eigenen Gesellschaft und Politik je weniger getraut?
Unvernehmen
Der Neologismus „Vergangenheitspolitik“ ist auf das engste mit dieser Projektion auf die Zukunft verknüpft. Die Erinnerungen an wechselseitige Verletzungen und Gewaltakte zumeist unter nationalen Rahmungen irritieren den europäischen Einigungsprozess und stimulieren zu deren Einhegung Gesten symbolischer und ökonomischer Wiedergutmachung. Geschichte wird mehr als zuvor ein Tauschmittel multilateraler Politik, aber gerade deshalb, wegen des Schuld/Schulden-Modus, taugt sie nicht zur europäischen Identitätsbildung, für die sie stets auch reklamiert wird. So gesehen konterkariert das Bedenkjahr mit seinen kumulativen Erinnerungsdaten 1848/1918/1938/1968 eine, nach innen wie nach außen, politisch verwertbare Erzählung. Entsprechend undeutlich – im Vergleich zum ähnlich gelagerten Projekt im Jahre 2005, mit seiner Vernetzung von Staatsakten, Ausstellungen, Happenings und Schulinitiativen – sind deshalb auch die Konturen der offiziellen Maßnahmen 2008. Oliver Rathkolb hat kürzlich zum Bedenkjahr gemeint, er fürchte die „kleinösterreichische Perspektive“, die nicht einmal dem Umstand Rechnung trägt, dass sie ein erhebliches Publikum mit Migrationshintergund adressiert. Er schlägt eine Öffnung zu europäischen und internationalen Linien vor, denen entlang Geschichte gedacht werden soll. Aber führt die anregende Überlegung, die österreichische Vergangenheit, konkret den Nationalsozialismus, „aus türkischer, kroatischer, serbischer Perspektive“ zu thematisieren nicht gerade auf die Aporien des Schuld/Schulden-Modus zurück? Geht es nicht vielmehr darum Formen zu finden, die andere historische Subjekte einsetzen, als die nationalstaatlichen Kollektive?
1848/1918/1938/1968 – was als politisch indiziertes „Bedenkjahr“ zu bilanzieren sein wird, lässt sich erahnen: Ein Appell, die pragmatisch gewordene Modernisierung von oben auszuhalten, weil die Emphase „historischer“ Akteure eine katastrophische Vergangenheit gebiert. Was dagegen wiederzuentdecken wäre: Die Konstitutierung der Politik gegen die Gouvernementalität durch die jeweils als unwahrscheinlich geltende Neuverteilung der Teilhabe am öffentlichen Leben, durch das Vernehmen der ausgesperrten Klassen, der diskriminierten Ethno-Communities, der unterdrückten Geschlechter, der entmündigten Generationen ...
1 Reinhard Juds Dokumentarfilm Fahrt in den Süden (2003) wäre ein Beispiel dafür, oder Ruth Beckermanns Jenseits des Krieges (1996).
Siegfried Mattl ist Historiker und Leiter des Ludwig Boltzmann- Instituts für Geschichte und Gesellschaft/Cluster Geschichte.