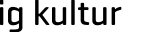De/Montage
RemRes ist eigentlich aus der Konstitution und fortgesetzten Arbeit einer Gruppe von Personen entstanden, die sich zur „Anticolonial Africa Conference Berlin 2004“ zusammengefunden haben, um eine die Konferenz begleitende Filmreihe mit Fokus auf antikoloniale Kämpfe zusammenzustellen. Damit wollten wir entgegen der in Europa verbreiteten Vorstellung zeigen, dass der durch die europäischen Mächte in Gang gesetzte Prozess der Eroberung und anschließenden Ausbeutung des afrikanischen Kontinents und der Demütigung seiner Bevölkerungen auf bedeutenden Widerstand traf.
MG: Wie kam es zur Gründung der „antikolonialen Filmgruppe“ RemRes und welche Ziele verfolgt ihr mit dem Projekt?
JEA: RemRes ist eigentlich aus der Konstitution und fortgesetzten Arbeit einer Gruppe von Personen entstanden, die sich zur „Anticolonial Africa Conference Berlin 2004“ zusammengefunden haben, um eine die Konferenz begleitende Filmreihe mit Fokus auf antikoloniale Kämpfe zusammenzustellen. Damit wollten wir entgegen der in Europa verbreiteten Vorstellung zeigen, dass der durch die europäischen Mächte in Gang gesetzte Prozess der Eroberung und anschließenden Ausbeutung des afrikanischen Kontinents und der Demütigung seiner Bevölkerungen auf bedeutenden Widerstand traf. Wir sind keine „antikoloniale Filmgruppe“, auch wenn das gut klingt – weil ich nicht weiß, was darunter zu verstehen wäre.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der „Kolonialismus“, ein Thema, das erst seit kurzem eine gewisse Öffentlichkeit gewinnt, was man etwa an den vermehrten Publikationen sieht, die in den letzten Jahren über die unterschiedlichen Facetten der deutschen kolonialen Geschichte herausgegeben worden sind. Dies bedeutet aber nicht, dass das Thema ein gesellschaftliches geworden wäre: Eine ernsthafte, profunde Reflexion und Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus und dem kolonialen Denken scheinen mir noch nicht in Sichtweite, wie die zahllosen so genannten Afrika-Filme, vor allem Fernsehproduktionen, zeigen. Wir sollten auch nicht vergessen, dass 2005 im Augsburger Zoo ein „african village“ errichtet wurde – trotz Protesten aus unterschiedlicher Richtung, die auf die direkten Parallelen mit „Völkerschauen“ hingewiesen haben. Insofern ist Deutschland auch ein Land – wie viele in Europa –, das seine postkoloniale Realität noch nicht wahrnehmen möchte.
BK: Zum einen denke ich, ist die Erinnerung an die koloniale Vergangenheit und damit verbunden auch die öffentliche Auseinandersetzung in Deutschland auf besondere Weise verschüttet bzw. zeigt sich, wie etwa Hito Steyerl (2003) sehr überzeugend herausgearbeitet hat, in sich überblendenden, einander aufladenden, ineinander widerhallenden und sich gegenseitig auslöschenden „Schichtungen von Geschichte“, deren historische, soziale und kulturelle Besonderheit etwa nicht mit einer einfachen Übertragung postkolonialer theoretischer Ansätze aus dem angloamerikanischen Raum adressiert werden kann. Um es kurz zu machen: RemRes steht in einer so verstandenen Konfiguration für den Versuch, in filmischen Formen historische Widerhalle aufzuspüren und zur Debatte zu stellen, aber auch durch Kurzschlüsse, d.h. neue Montageleistungen, Dringlichkeiten herzustellen und zu aktivieren. Die Orte, an denen RemRes operiert, sind dabei nicht an klassifizierte Szenen gebunden, auch wenn die Entscheidung für eine Arbeit mit Film, die in unserem Falle ganz ausdrücklich jenseits des klassischen Kinos nach Kino sucht, sicherlich den Raum der Intervention und Adressierung strukturiert.
SH: Ausgehend von der Situation, in einer (post)kolonialen, rassistischen Gesellschaft zu leben und selbst Teil dieser Mehrheitsgesellschaft zu sein, ist es mir ein Anliegen, nach den Wurzeln zu graben, die so tief in unserer Gesellschaft verhaftet sind, dass wir wohl noch lange ackern müssen. Dies gilt auch für „linke Gegenöffentlichkeiten“, denn: auch wenn postcolonial studies hier vielleicht sogar sehr präsent sind, heißt das noch lange nicht, dass „Helfersyndrome“ und „patronizing“ nicht auf der eigenen Tagesordnung wären. Mit unserem Akzent auf „Widerstand“ möchten wir die aktive Rolle der „Kolonisierten“ in der Auseinandersetzung mit den Kolonialisierer_innen herausstellen und so zu einer komplexeren und multiperspektivischen Geschichtsschreibung beitragen.
JB: Kolonialismus ist inzwischen Thema auf den dritten Seiten der Tageszeitungen und ein Fachbereich in Universitäten. Post-kolonial bezieht sich hierzulande endlich auch auf deutsche Kolonien und nicht nur auf akademische Literatur aus den USA oder Großbritannien. Und auch migrationsbezogene bzw. antirassistische Projekte merken inzwischen, dass sie um post/koloniale Fragen nicht herum kommen. Für uns ist der Kunst-Kontext als Gegen-Öffentlichkeit zwar sicherlich dominant, allerdings fand etwa in Paris eine unserer Vorführungen in einem algerischen Café statt, wo je nach Alter das Publikum am Tresen entweder selbst Teil der „Schlacht um Algier“ war, oder sich zumindest daran erinnern wollte, wenn es schon die Mehrheitsfranzosen nicht tun. Wichtig ist: Wir setzen bei der Erkundung des EUROPÄISCHEN Post/Kolonialismus an, der „Europa“ gezeichnet hat. So wie „Afrika“ gezeichnet wurde auf den Berliner Kiepert-Karten und mit den vormaligen kolonisierenden Ländern vielfältige, miteinander verschränkte und multidirektionale Verbindungslinien aufzeigt. Ausgehend vom Material der Filme arbeiten wir mit deren Eigensinn, bevorzugt in der Regie von Personen des „Globalen Südens“, der sich bis in die Metropolen des Nordens zieht.
BK: Ausgehend von meiner Position als Schwarzer Aktivistin interessiert mich, in welchem begleitenden Rahmen Eure Veranstaltungen stattfinden? Ich denke, dass Ihr Thematiken ansprecht, bei denen ich nicht bereit wäre, sie in einem Kreis von Mehrheitsangehörigen zu besprechen. Gerade wenn es um psycho-soziale Auswirkungen von Kolonialismus auf den/die Kolonisierte geht oder um Widerstandsstrategien, welche auch im hier und jetzt für People of Color von Bedeutung sind.
BK: Das ist eine sehr wichtige Frage. Und natürlich lassen sich die Räume und Äußerungen, mit denen wir interagieren, weder vollständig „kontrollieren“ noch im Voraus jeweils abschätzen. Ich selbst bin erst später in die Arbeit mit RemRes eingestiegen und beobachte, dass unser Publikum vielfach erst mal beschäftigt ist mit der Rezeption und Verarbeitung des Materials, also des Auftauchens von Perspektiven der Betrachtung, die nicht so geläufig sind. Und natürlich gibt es hier viele „heikle“ Situationen, verletzende Naivität und Unwissenheit, aber auch berechtigte und fordernde Ungeduld. Hate speech weisen wir in aller Deutlichkeit zurück, wo wir sie ausmachen (können). Wer in unserem Publikum allerdings was wann mit wem zu besprechen oder nicht zu besprechen bereit ist, bleibt die Entscheidung, die jedeR für sich selbst trifft.
Viel wichtiger ist mir, den Blick auf die Vor-Entscheidungen zu schärfen, die wir als Gruppe mit unserer (Selbst)Darstellung und unseren Angeboten treffen – und ich sage „schärfen“, weil mir scheint, dass wir nicht so sehr an der politischen Strategie von Separation oder Selektion ansetzen, sondern bei der Verschiebung und Rekonfiguration, was von wem in welcher Weise zur Sprache gebracht und womit in Verbindung gebracht werden darf. Das ist die Arbeit an unseren Programmen, die immer wieder an ihren eigenen Unzulänglichkeiten und an Unvermögen, aber auch an dem Gegebenen, also an dem Material, den Bildern, dem Horizont des Vorstellbaren, der uns als kulturelles Repertoire zur Verfügung steht, scheitert und scheitern muss – nicht zuletzt bei der Art unserer Zusammensetzung als Gruppe, bei der es mir aber darum geht, sie an Herausforderung und Kritik heranzutragen, so weit es „intern“, also unter uns, überhaupt möglich wird, das (noch) zusammenzuhalten bzw. zur Sprache zu bringen. Es ist heikel, aber ich mag es, auf ein politisches Versprechen zu setzen, das mit Adressierung/ Wahrnehmung (die immer Differenz bedeutet) UND Dis-Identifikation rechnet.
JEA: Es ist nahezu unmöglich, einen Diskurs über den Kolonialismus zu führen unter Auslassung der schmerzhaften Auswirkungen des kolonialen Denkens. Dabei ist aber zwischen diskursiver Adressierung und Erfahrungsaustausch zu unterscheiden. Letzterer ist zwischen Nachfahren Kolonisierter und Nachfahren der Kolonisierer_innen nur beschränkt möglich oder sogar in den meisten Fällen fragwürdig oder problematisch. Und ich kenne Räume, die einen solchen Dialog anbieten, nicht. Allerdings dürfte dabei kein Opfer-Täter-Verhältnis zustande kommen, sonst schlüge unsere Zielsetzung von vorne herein fehl. Ehemalige Kolonialmächte wie Deutschland sollen Entkolonisierungsprozesse in ihren Gesellschaften vorantreiben wegen des Schadens, den der Kolonialismus angerichtet hat und immer noch anrichtet. An solchen Prozessen können – und ich behaupte: sollen – „Ex-koloniale-Subjekte“ oder ihre Nachfahr_innen, die selbst Teil dieser Gesellschaften (geworden) sind, teilnehmen. So sehe ich jedenfalls meine Rolle in der Gruppe, auch wenn ich nicht behaupten würde, für alle Schwarzen Menschen dieser Erde zu sprechen.
JB: Ich bin Teil der Mehrheitsgesellschaft und möchte hier nicht weiter trennen. Keine Frage, dass das nicht immer aufgeht. Ansonsten halte ich es mit dem KA-Manifest: „Kanak Attak fragt nicht nach dem Pass oder nach der Herkunft, sondern wendet sich gegen die Frage nach dem Pass und der Herkunft. Damit bewegt sich das Projekt in einem Strudel von nicht auflösbaren Widersprüchen, was das Verhältnis von Repräsentation, Differenz und die Zuschreibung ethnischer Identitäten anbetrifft.“ Ein früher Streitpunkt, mit dem wir zu hatten, war etwa: Ist die Situation, von der wir ausgehen, post- oder neo-kolonial? Kann man die Brüche der Libération übergehen und von einer Kontinuität sprechen? Und es scheint mir, wir sollten es kompliziert machen in einem Land, das den Holocaust diskutieren muss.
BK: Wie funktioniert die Auswahl der von euch gezeigten Filme?
SH: In unserem ersten Filmprogramm haben wir hauptsächlich afrikanische Perspektiven auf Geschichte präsentiert, um ein Gegengewicht zur westlichen hegemonialen Geschichtsschreibung zu schaffen – das ist auch bis heute Schwerpunkt, lässt sich aber nicht immer eins zu eins realisieren, da die Bildproduktion selbst extrem ungleichgewichtig verteilt ist. Hier arbeiten wir auch mit Gegenüberstellungen und Kommentaren, um das Augenmerk auf die Blickregime zu lenken. Wir sind uns dabei allerdings auch der Machtwirkungen von Bildern, selbst wenn sie sozusagen kritisch wiederholt werden, bewusst und versuchen damit vorsichtig umzugehen.
JEA: An einem Thema zu arbeiten, heißt für uns, bei allerlei Quellen zu suchen: Zeitungsberichte, Fotografien, Literatur oder Essays und vor allem Filme. In diesem Materialfundus navigieren wir ohne Einschränkung, ziehen Verbindungen, weisen auf Details hin und entwickeln Hypothesen, die wir zur Diskussion stellen.
SH: Auf die rassistische deutsche Gesetzgebung der Residenzpflicht reagierend, haben wir anfangs etwa Film-Sichtungen in „Asylbewerber_innenheimen“ außerhalb Berlins veranstaltet – auch um ein erweitertes Publikum bzw. Diskussionspartner_innen zu erreichen. Trotz der Wichtigkeit dieser Termine schien es mir doch problematisch, an einen solchen Ort staatlicher Kontrolle und Repression von „außen“ zu kommen und dann wieder weg zu gehen, ohne Option auf eine längerfristigere Perspektive.
JEA: Unterbringungen für Asylsuchende in Deutschland oder anderswo sind Orte der Unterdrückung und des Unfassbaren, was Demütigung und soziale Deprivation angeht. Das Leben dort wird auf das strikte Minimum reduziert. Sogar das Recht auf politische Aktivitäten wird Asylsuchenden verwehrt, dazu kommt noch die so genannte Residenzpflicht. Dorthin zu gehen und über Kolonialismus und Migration zu debattieren, hat vielerlei Bedeutungen. Erstens manifestieren wir damit unsere Solidarität mit allen Menschen, die dort leben müssen, zweitens setzen wir ein Zeichen gegen den heutigen strukturellen Rassismus in Europa als Erbe des Kolonialismus und stellen ihn somit auch in Frage. Postkoloniale Gesellschaften müssen einen besseren Umgang mit allen Formen von Migration finden. Was die Frage von Kooperationen mit selbstorganisierten schwarzen Gruppen anbelangt: Formale und dauerhafte Kooperationen gibt es bei RemRes keine. Mit Abok, dem schwarzen Berliner Theaterensemble, das Philippa Èbéné ins Leben gerufen hat, haben wir im November 2005 eine einmalige und erfolgreiche Veranstaltung zum Maji Maji Krieg im damaligen Deutsch Ostafrika (1905-1907) auf die Beine gestellt. Letztendlich gab es bei unseren Aktivitäten eine Reihe punktueller, situierter und situativer, aber nicht längerfristig verpflichtender Kooperationen.
JB: Im Ideal sind unsere Programme mit kommentierten Filmausschnitten Montage und Widerstreit zugleich: Zwischen uns und dem Material, untereinander im Verlauf der Präsentation, und zugleich mit den anderen Beteiligten. Erschütterungen sind hierbei erwünscht ...
BK: ... wobei die von uns angestrebten Erschütterungen sich dort einreihen wollen, wo sich bereits andere gesellschaftliche Projekte an der Destabilisierung und Entplausibilisierung der „bibliothèque coloniale“ (Mudimbe) zu schaffen machen.
Literatur
Hito Steyerl (2003): „Postkolonialismus und Biopolitik“. In: Spricht die Subalterne deutsch? Migration und postkoloniale Kritik. Münster
Das Kanak Attak-Manifest:kanakattak
Remember Resistance besteht zur Zeit aus Julien Enoka Ayemba, Jochen Becker, Sonja Hohenbild und Brigitta Kuster
Interview: Belinda Kazeem, Markus Griesser