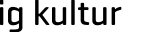Die Chancen der Krise
Die Linke hat – je orthodoxer, umso offener – ein gutes Verhältnis zu Krisen des Kapitalismus. Jede Krise zeige, dass man mit dem „Chaos der Märkte“ keine Wirtschaft und keinen Staat machen könne.
Die krisenfreudige Linke ...
Die Linke hat – je orthodoxer, umso offener – ein gutes Verhältnis zu Krisen des Kapitalismus. Jede Krise zeige, dass man mit dem „Chaos der Märkte“ keine Wirtschaft und keinen Staat machen könne. Besonders haltlose Optimisten sahen jede Krise schon als die abschließende – oder wenigstens die vorletzte –, nach der aus den Trümmern des zusammengebrochenen Kapitalismus der Phönix des Sozialismus, wenn nicht Kommunismus aufsteigen würde. Beides sind eminent bürgerliche Fantasien.
Das Bild vom „Chaos der Märkte“ hat als Kontrast-Hintergrund die autoritäre Vorstellung von einer wohlgeordneten Wirtschaft und Gesellschaft – wohlgeordnet nach dem Muster eines Kasernenhofs mit seiner strikt geregelten Befehlshierarchie. Verwirklicht sahen das die Anhänger solcher „Ordnung“ in der Kriegswirtschaft des Ersten Weltkriegs. Der Realsozialismus des 20. Jahrhunderts ist aus verschiedenen Gründen über dieses Modell der Kriegswirtschaft nie lange hinausgekommen. Für die ihm unterworfene Bevölkerung hat es Einschränkung des Konsums und jeweils nationale Anstrengung, um die industrielle Produktion möglichst hochzutreiben, bedeutet. Für Linke sollte es eigentlich seit 1927, dem Ende der NEP und dem Beginn der stalinistischen Kollektivierungen in der Sowjetunion, diskreditiert sein und nicht erst seit 1989, wie für die Kalten Krieger, die den Realsozialismus respektierten und fürchteten, so lange militärische Macht dahinter stand.
Das andere Bild, das vom Zusammenbruch, lässt sich auf Sintflut, Sodom und Gomorrha und die Apokalypse zurückverfolgen, seine bürgerliche Ausprägung aber hat Richard Wagner, der gescheiterte Revolutionär von 1848, in der „Götterdämmerung“ auf die Bühne gebracht: Nicht mehr der Zorn des Herrn über die verderbte Menschheit setzt das Ende, nach dem erst ein Neu-Anfang möglich wird, sondern die Herrschenden, die mit ihren eigenen Gesetzen nicht zurecht kommen, führen es selbst herbei. Jedenfalls besteht es in allgemeiner und gründlicher Vernichtung, möglichst in einem Weltenbrand. Danach kann eine andere, „reine Rasse“, die ohne Schuld ist, eine neue Welt aufbauen. Kein Wunder, dass die Nazis mit Wagner, vom „Rienzi“ bis zum „Ring“, so viel anfangen konnten.
Bei Marx findet sich keine dieser Fantasien. Die „freie Assoziation der Produzenten“ verträgt sich nicht besonders gut mit zentral-bürokratischer Planung. Noch weniger verträgt sich das Bild von der „Revolutionierung“, also der langsamen Umwälzung der Gesellschaft, die allmählich die Elemente einer neuen Produktionsweise hervorbringt, mit Apokalypse und Götterdämmerung. An den Krisen war für Marx vor allem interessant, wie sie – von den Herrschenden – in neuen Kapitalstrategien, deren Elemente er als (dem tendenziellen Fall der Profitrate) „entgegenwirkende Ursachen“ beschrieb, bearbeitet und bewältigt wurden: grundsätzlich auf Kosten der Arbeiterschaft, aber in der Konkurrenz der Einzelkapitale auch mit dem Effekt der Kapitalvernichtung. (Das ist die realistische Reduktion der „Götterdämmerung“ auf das, was auch bürgerliche Ökonomen als die „reinigende Wirkung“ von Krisen sehen: Die – meist kleineren – Einzelkapitale, die zu spät gekommen und sonst nur im allgemeinen Pilotenspiel mitgeschwommen sind, gehen unter.)
Und um auch das noch explizit zu sagen: Krisen sind nach Marx (wie nach der bürgerlichen Ökonomie) ein normaler Bestandteil des Funktionierens von Kapitalismus, nicht sein Ende. Seit der großen Depression im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde das Instrumentarium zum Umgang mit Krisen immer weiter entwickelt: Hauptsächlich besteht es aus der Vergrößerung und internen Diversifizierung der wirtschaftlichen Einheiten (von der Aktiengesellschaft bis zu Trusts, Holdings und Investment-Gesellschaften) einerseits, andererseits in staatlichen Eingriffen zur „Glättung“ der Krisen und zur Verkürzung der Zeit bis zum Neu-Abheben des nächsten Zyklus.
Die wichtigste dieser Erfindungen war auf der Wirtschaftsseite der Fordismus: die Strategie der Massenproduktion von Konsumgütern und des Einsatzes der Bevölkerung als „Konsumkraft“. Auf der Staatsseite war es die zugehörige Wirtschaftspolitik des Keynesianismus: durch Sozialpolitik, Erleichterung von Schuldenmachen und die staatliche Erzeugung von Löhnen in anderen Bereichen als der Konsumgüterindustrie (Rüstungsindustrie oder Infrastruktur) diese Konsumkraft zu verstetigen und sie zum tatsächlichen Konsum (also Kauf von Waren) zu veranlassen. Diese beiden Strategien haben Kapitalismus zwar nicht grundsätzlich, aber doch folgenreich verändert: Die Stützung der Wirtschaft mit Mitteln der Allgemeinheit geschieht jetzt „durch die Bevölkerung hindurch“ und mit ihrer doppelten Beteiligung: nicht nur beim Aufbringen der (Sozialversicherungs- und Steuer-)Mittel, sondern auch beim Verteilen durch Konsum. Und dass wir Geld ausgeben können, gibt uns die Illusion von Wohlstand. Geld ausgeben zu können, gilt seither als das entscheidende Merkmal für „gutes Leben“ – obwohl immer wieder die Einsicht dämmert, dass Zeit zu haben oder selbstbestimmt arbeiten oder sich auf einen Kreis von Freunden, in dem Konkurrenz aufgehoben ist, verlassen zu können, vielleicht mehr wert wäre.
... und ihre Enttäuschungen
Wenn es noch eines Nachweises bedurft hätte, zeigt sich jetzt überdeutlich, dass die parlamentarische Linke, inklusive der Partei „Die Linke“ in Deutschland, nichts will als einen moralischen und national verpflichteten, staatlich regulierten Kapitalismus. Das Verkaufsargument dafür sind die Arbeitsplätze, jetzt auch die Sparguthaben, in den USA, das Haus und die Alterssicherung der „kleinen Leute“, die „gerettet“ werden müssten. Und das geht nur über den Umweg der „Rettung“ von maroden Banken, Autofirmen und durch Staatsaufträge an „die Wirtschaft“. Inwiefern dadurch in den USA die Häuser für ihre überschuldeten Eigentümer gerettet werden, kann ohnehin niemand sagen, und man hört auch nicht, dass etwas von der Art geschehen würde. Und über Maßnahmen, die direkt bei den Schuldnern ansetzen (etwa ein Moratorium der Kündigung von Hypotheken oder sogar eine staatliche Übernahme der Kredite oder wenigstens der Zinsen) und nicht bei den Bilanzen von Banken (deren „giftige“, also wertlos gewordenen Kredit-Spekulations-Papiere die Zentralbank aufkauft), wird nicht einmal fantasiert.
Zugleich ist die Enttäuschung groß, dass nach den Umfragen die Anhängerschaft der parlamentarischen „Linken“ in der Krise nicht gewachsen ist. Wenn die Leute Angst um ihr Gespartes und um den Arbeitsplatz haben, halten sie sich an die Parteien und Politiker, die im Staat etwas zu sagen haben, nicht an die Opposition. In der Krise werden die Leute nicht rebellisch, sondern noch ängstlicher, defensiv und sicherheitsorientiert. Natürlich mosern und stänkern sie und sind generell undankbar, aber sie wollen das Personal nicht gerade jetzt austauschen – zumal sich die angebotene Alternative so grundsätzlich auch wieder nicht von dem unterscheidet, was man schon hat.
Sich den Kopf des Kapitals zerbrechen
Die TeilnehmerInnen von „linken“ Diskussion haben in der Situation die Neigung, in den Stammtisch abzurutschen, also die bessere Regierung sein und mit den jetzt quasi verstaatlichten Banken eine bessere Politik erfinden zu wollen. Das sind, wie es der Stammtisch so an sich hat, mehr oder weniger autoritäre Größenfantasien. Jahrzehnte lang wurde für den fordistischen Korporatismus, in dem die Organisationen der Arbeiterschaft noch integriert werden mussten, die Begrenztheit der Möglichkeiten von staatlicher Regulation analysiert. Dann konnten wir beobachten, wie im neoliberalen Staat des strukturellen Populismus die Wirtschaft durch Entsenden von eigenem Personal und durch perfektionierten Lobbyismus die staatlichen Dinge selbst in die Hand nahm. Und jetzt, mit nachhaltig geschwächten Gewerkschaften und der populistischen Identitäts- statt Interessenpolitik, träumen wir davon, Staatseingriffe könnten den Kapitalismus auch nur zähmen?
Tatsächlich wird auch diesmal wieder sichtbar, dass die Krise die Chancen für eine radikale Politik gerade nicht verbessert – im Gegenteil. In der Krise wird die Kapitalseite besonders aktiv und kennt ihre Interessen besonders genau. Und sie nimmt den Staat besonders gründlich in Dienst. Das Beste, das wir erhoffen können, ist, dass das Gesamt-Kapital-Interesse auch ein paar Interessen der Arbeitsseite mit einschließt, mehr jedenfalls, als es der Fall ist, wenn sich eine Kapital-Fraktion einseitig durchsetzt. Aber das Grundproblem von Neoliberalismus, der Mangel an profitablen Einsatzmöglichkeiten für zu viel potenzielles Kapital, wird durch die Kapitalvernichtung beim Platzen der Blase nur vorübergehend erleichtert, nicht gelöst.
Das Mindeste an linkem Stammtisch könnte daher weniger in der Sorge um Finanzmarkt-Kontrollen und Manager-Gehälter bestehen, als vielmehr im Hinweis auf die Bereiche von Gesellschaft, die dringend der Bearbeitung und daher auch der Investition bedürfen: Es ist bekannt genug, dass das der Hunger in der Welt und ein umweltverträgliches Leben und Wirtschaften sind. Nicht bekannt genug ist vielleicht, dass beides nur mit dezentralen Technologien und Organisationen erfolgreich anzugehen ist. Das heißt, diese Entwicklungen müssen den Konzernen aus der Hand genommen und (etwa nach dem Modell der Mikrokredite und anderer Infrastruktur-Leistungen) den Leuten selbst und an Ort und Stelle ermöglicht werden – in Bangladesh wie in Oberösterreich. Wenn die Linke schon unbedingt Ideen entwickeln will, wie man dem Kapital aus der Krise hilft, dann wären das die Bereiche, mit denen sie sich befassen, und die Orientierungen, in denen das geschehen sollte. Wenn schon eine Rückkehr von Keynesianismus, dann vielleicht eines weltweiten statt des üblichen national bornierten. Und wenn schon sich den Kopf des Kapital zerbrechen, dann den der richtigen Fraktionen: den der kleinen und mittleren, den der technisch und organisatorisch interessierten Unternehmen, denen es auch um eine Lebensweise geht.
Die radikale Strategie von „Revolutionierung“ der Gesellschaft besteht nicht in staatlicher Politik. Sie besteht in der autonomen Entwicklung von alten und neuen – zum Beispiel genossenschaftlichen, Realtausch-, solidarischen, (in der Energieversorgung) autarken – Formen, in denen schon jetzt versucht wird, anders zu leben und zu wirtschaften: freie Assoziation der Produzenten. Mit staatlicher Politik wären allenfalls (und auch das ist nicht einfach) die Hindernisse zu beseitigen, die dem heute entgegenstehen. Und das wird eher in Zeiten der Ruhe und der Routine möglich sein, als in der Krise der Kapitalreproduktion. So lange die Linke nur wieder den Staat übernehmen will, wird sie zu Recht enttäuscht werden – indem das nicht gelingen kann, noch mehr aber, falls es ihr (wofür es ja warnende historische Beispiele gibt) einmal doch gelingen sollte.
Der Text wurde redaktionell gekürzt, die Langfassung des Textes ist ab Ende Januar nachzulesen auf Links-Netz.
Heinz Steinert ist Professor für Soziologie (emeritiert) an der J.W. Goethe-Universität Frankfurt