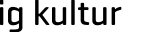Hundstrümmerl und Opferbild. Zur visuellen Repräsentation von (Gewalt gegen) Frauen im Wiener Stadtraum
Seit 2000 steht ein Glaskubus unter der Brücke der U-Bahnstation Josefstädterstraße am Wiener Gürtel. Rund 80.000 Menschen in Autos fahren, rund 5000 gehen täglich am Glaskubus vorbei, gehen mit Hunden äußerln, mit Kindern oder Kinderwägen spazieren, zur U-Bahn, zur Müllsammelstelle oder abends in die nahe gelegenen Gürtel-Lokale.
Seit 2000 steht ein Glaskubus unter der Brücke der U-Bahnstation Josefstädterstraße am Wiener Gürtel. Rund 80.000 Menschen in Autos fahren, rund 5000 gehen täglich am Glaskubus vorbei, gehen mit Hunden äußerln, mit Kindern oder Kinderwägen spazieren, zur U-Bahn, zur Müllsammelstelle oder abends in die nahe gelegenen Gürtel-Lokale. Gegenüber liegt eine Beratungsstelle des Sozialamtes für Obdachlose. Der Kubus mit dem Namen Der Transparente Raum ist eine speziell für Frauen und für diesen Ort konzipierte Skulptur der Wiener Künstlerin Valie Export. Auftraggeberin war das Frauenbüro der Stadt Wien, das im März 1999 den Arbeitsschwerpunkt "Frauen sichtbar machen" gestartet hatte. Erklärtes Ziel: die in Auftrag gegebene Skulptur solle "keinesfalls ein Denkmal im traditionellen Sinn" werden. Der Traditionsbegriff der Behörde lässt sich diskutieren, "sichtbar gemacht" wurden jedenfalls weniger "Frauen" im allgemeinen, als der Transparente Raum und mit ihm eine renommierte österreichische Künstlerin.
Die sich grundsätzlich durch ihre Dysfunktionalität allen partizipatorischen Verwendungen verwehrende Glas-Skulptur, die den Arbeitstitel "Frauenbrücke" trug, wird erst im nachhinein ins Diskursive und Funktionale gezerrt. Die Künstlerin zu einer möglichen Raumnutzung: "Der Raum ist begehbar ..., es können kleine Ausstellungen ... stattfinden, – Dokumentationen, Keramik, Kunsthandwerk etc, ..., es können Installationen aufgestellt werden. ... (...) Ich könnte mir eine transparente Text-Installation ... vorstellen, die permanent hängt, wenn keine Ereignisse stattfinden, und einen Text einer österreichischen Literatin zeigt. (...) Auf den Bodenflächen neben den Bäumen könnten kleine rechteckige Wasserbecken sein ... Die Gesichter der Betrachtenden, die sich über das Wasserbecken beugen, reflektieren sich auf der Spiegeloberfläche des Wasserbeckens, überlagert von der Steinwand des Gürtelbaues, die sich ebenfalls spiegelt. (...) Ebenso wäre ein Vorschlag von mir, dass sich durch die Bogenräume ein rubinroter Strich zieht, eine rubinrote Linie, die in den Boden eingearbeitet ist, als Installationszitat 'Maulwurf' von Franz Kafka." Abgesehen davon, dass diese Vorschläge der Künstlerin nicht realisiert wurden: Die Skulptur transportiert einen exklusiven Kunstbegriff, ohne Alternativen oder eine Diskussion anzubieten. Gewiss, sie könnte auch als metaphorische Übersetzung gesellschaftlich fixierter Konzepte von "Innen" und "Außen" gelesen werden. Aber Symbole werden von verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich interpretiert. Und wenn sich mir die Qualität dieser Skulptur nicht erschließt, wird das Gefühl von "Draußen-Sein" schnell näher liegen als Freude darüber, dass der Glaswürfel "Frau-Sein" als gemeinsamen Nenner heterogener Gruppen bestimmt und Frauen – neben Maria Theresia und Kaiserin Sisi – im Stadtraum sichtbar machen soll. Darauf bezieht sich Stella Rollig im diskursiven Nachschlag für den Transparenten Raum, wenn sie konstatiert: "Um ... trotz aller Transparenz dieses Baus nicht eine Verdeutlichung und Verhärtung sozialer Grenzen zu verursachen, sollte 'Kultur' in einem weiteren Sinn verstanden werden als nur im Rahmen des Veranstaltungsbogens von anspruchsvoller Kunst, Literatur, Musik. Ein Positivszenario lässt sozial und bildungsmäßig Benachteiligte nicht draußen, sondern zeigt die Frauen-Brücke als einen Ort, an dem Grenzen im physischen UND institutionellen Sinn durchlässig werden."
Am Gürtel liegt ein Hundstrümmerl, das über (exklusive) Bildung funktioniert. Frauen, die eintreten, befinden sich auf dem Präsentierteller, voyeuristischen Blicken ausgesetzt. Warum sollte mich als Anwohnerin diese Skulptur interessieren? Weil sie offizielle Stellen als "mein Glück" verstanden haben wollen? Weil sie von einer Frau produziert wurde?
Der Transparente Raum wurde im Rahmen des EU-Programms URBAN mit dem Ziel realisiert, so genannte städtische "Problemgebiete" zu entschärfen. Seit 1998 gibt es in der Stadtbaudirektion Wien auch die Leitstelle "Alltags- und frauengerechtes Planen und Bauen". Sämtliche Wohnbauvorhaben, die öffentliche Gelder beanspruchen wollen, werden hier unter dem Aspekt "frauengerechter Wohnbau" beurteilt. Berücksichtigt werden u.a. "Anforderungen für die Haus- und Familienarbeit", aber im Speziellen auch der "Sicherheitsaspekt". So wird auch bestehende Bausubstanz dahingehend untersucht, wie weit so genannte "Bausünden" durch den gezielten Einsatz von Licht kostengünstig zu mildern sind, eine "Arbeitsgrundlage in Form von Negativ- und Positivbeispielen für PlanerInnen und EntscheidungsträgerInnen" wurde erarbeitet. Die Leiterin der Leitstelle, Eva Kail, betont als positiven Aspekt, dass dank der Arbeit der Leitstelle der Terminus "Angsträume" zu einem akzeptierten Begriff innerhalb der Stadt Wien geworden ist.
Die Bezeichnung "Angsträume der Frauen" verortet "das Problem" jedoch eindeutig auf Seiten der Frauen. Sie haben ein Problem, sie brauchen Sicherheitsmaßnahmen und Frauenkunst, und der Staat eilt mit Sicherheitskonzepten zu Hilfe. Dabei wird mit der Frau als zu beschützendem Gut operiert und daraus moralische Handlungsfähigkeit abgeleitet. Auch die Location des Transparenten Raumes, der Gürtel, wird als "Angstraum" kategorisiert, vor allem mit der symbolischen Speerspitze des Straßenstrichs. Nun ist es aber so, dass die Sexarbeiterinnen durch diskriminierende und gewalttätige sicherheitspolizeiliche Registrierungen stigmatisiert werden, Männer als Freier dagegen kein Thema sind und anonym bleiben. Es ist nicht die Präsenz von Sexarbeiterinnen am Gürtel, sondern deren politische Diskursivierung und einseitige Verortung auf Seiten der Frauen, die Ängste produziert. Anstatt sich mit den Gewaltstrukturen im Geschlechterverhältnis auseinander zu setzen, erschöpfen sich Diskussionen in einer technokratischen Symptombekämpfung, d.h. einerseits mit dem Konstrukt der "Angsträume" und andererseits der Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen.
Ordnung, Sicherheit und Unauffälligkeit sind Konzepte, die an öffentlichen Plätzen durchgesetzt werden. Von Stadtbehörden sanktionierte Kunstwerke im Stadtraum, selbst so dysfunktionale wie der Kubus, werden zu Funktionen dieser Politik. So werden Impulse in Richtung Regelüberschreitung durch bauliche Maßnahmen verhindert, und auch der Transparente Raum soll den Angstraum Gürtel attraktiver machen. Das erste Paradigma, das ich für die (kulturpolitische) Repräsentation von Frauen im öffentlichen Raum ausmache, ist also jenes des Hundstrümmerls. Es handelt sich um Kunstwerke "von und für Frauen", die – ohne bestehende Machtstrukturen und Ungleichheiten zu thematisieren – öffentlichen Raum "attraktivieren". Und dabei von oben herab verlautbaren: "Wir Frauen sind eine große Gruppe mit dem gemeinsamen Nenner 'Opfer'".
2. Opfer + Täter
Im Laufe eines Jahres werden in Österreich rund eine Viertel Million Frauen von ihren Lebenspartnern körperlich schwer misshandelt. Neuere Offensiven gegen diese Gewaltverhältnisse und Gewalttaten wie die von Männern durchgeführte Kampagne "White Ribbon – Männer gegen Männergewalt" und die Informationskampagne der SPÖ-Frauen zum Thema Stalking richten sich an Täter im einen, an sogenannte "Opfer" im anderen Fall. Die Taktik ist im Rahmen dieser dualistischen Logik eine ähnliche, die Rede ist von "Opfern – meist Frauen", von einer gefährlichen "Lücke im Opferschutz", "Opferschutzeinrichtungen" und einem "Opferschutzgesetz" (www.wien.spoe.at). "Stalking betrifft jede 4. Frau in Wien. Die Täter: Der Ex, ein Bekannter, der Kollege. Ein Gesetz gegen Psychoterror muss her! Eine Initiative der SPÖ Frauen", lese ich auf Plakaten und Infokarten, die im Dezember 2004 im Rahmen einer groß angelegten Informationskampagne zum Thema Stalking in ganz Österreich verteilt wurden. Und: "Wer seine Frau schlägt, hat bei mir kein Leiberl. Es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt an Frauen. Zeigen Sie als Mann Verantwortungsgefühl und Haltung. Tragen sie den White Ribbon", sagt der österreichische Fußballstar Hans Krankl auf einem seit Dezember 2004 im U-Bahnbereich der Wiener Linien affichierten Plakat. Anlass für beide Kampagnen waren die "16 Tage gegen Gewalt an Frauen", die jährlich zwischen dem 25.11. und 10.12. weltweit stattfinden.
Der Begriff "Opfer" war lange Zeit eine zentrale Kategorie feministischen Denkens. Seit den 1980er Jahren erfolgt jedoch eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Label. Die Bezeichnung "Opfer" dient nämlich nicht nur der Beschreibung von Gewalt und Unterdrückung, sondern auch einer totalisierenden Zuschreibung von Passivität und Ohnmacht. Die feministische Theologin Maria Moser betont in diesem Kontext den fundamentalen Unterschied zwischen Opfer-Sein und Als-Opfer-wahrgenommen-Werden. Das Wahrnehmen der eigenen Benachteiligung kann Grundlage für Veränderungshandeln werden. Gleichzeitig bleibt das "Opfer" im Rahmen der Fremdwahrnehmung aber auf seinen Objektstatus festgelegt, wird vom Objekt fremder Gewalt zum Objekt fremder Hilfe. Moser definiert die Beschreibung einer Person als "Opfer" als Schlüsselstrategie der Dominanz: Frauen bleiben bloße Objekte von Gewalt und Unterdrückung und verschwinden dabei in unserer Wahrnehmung als handlungsfähige Subjekte. Eine positive Verwendung dieses Begriffs ist deshalb aus feministischer Sicht nur begrenzt möglich.
Der Fokus auf Sicherheit/"Opferschutz" ist ebenso problematisch wie die Stigmatisierung von Frauen als Opfer in einem dichotomen Täter-Opfer-Schema. Es sind die Frauen, die angeblich ein "Problem" haben, die Sicherheitsmaßnahmen und ein Opferschutzgesetz brauchen: Man eilt mit Sicherheitskonzepten zu Hilfe und operiert dabei mit dem Bild der Frau als "Opfer". Daraus wird moralische Handlungsfähigkeit für die Helfer abgeleitet, während Opfer mit einem Handlungstabu belegt werden. Das Paradigma Nr. 2 legt Frauen auf eine Opfer-Identität fest. Während Aufklärungsarbeit zum Thema Gewalt gegen Frauen mit dem Bild der Frau als "Opfer" betrieben wird, steht ihr Opferstatus selbst nicht zur Diskussion. Im Dunkeln bleiben jene Machtstrukturen innerhalb unserer Gesellschaft, die es erst ermöglichen, dass Frauen immer wieder auf die Rolle des Opfers festgelegt werden. Gleichzeitig werden Frauen als unmündig und abhängig (von GönnerInnen, die Raum für sie gestalten und sie beschützen) beschrieben.
Gerade im öffentlichen Raum, wo Bilder von passiven Frauen/Sexobjekten allgegenwärtig sind, wäre es wichtig, andere Bilder und Slogans zu installieren. Mit dem Ziel, Frauen zu stärken, ihnen ihre Macht und eigenen Handlungsspielräume vor Augen zu führen, das Bild, das Frauen als schwach und hilfsbedürftig zeigt, zu verweigern, umzuschreiben und zu attackieren: "Vergewaltiger angreifen. Überall – mit allen Mitteln. Gewalt gegen Frauen ist nie eine Privatangelegenheit: hinschauen, einschreiten, Hilfe holen, zuschlagen", stand auf einem von autonomen Gruppen gestalteten Plakat, das zeitgleich mit der Stalking-Kampagne affichiert wurde – wohl als Reaktion darauf. Diese Aufforderung fokussiert nicht auf Opfer, sondern diskutiert Täter auf der Ebene des Auslotens persönlicher Handlungsstrategien und -kompetenzen.
3. Konsumentin + Produzentin
Würde das Sprengen des Opfer-Täter-Komplexes, der hierarchischen Aufteilung in Konsumentinnen und Produzenten als strategisches Ziel von Frauenpolitik verstanden, müsste man freilich woanders ansetzen als bei klassischen Kunstobjekten oder Aufklärungskampagnen im öffentlichen Raum, etwa bei einer Beratungspraxis, die sich nicht darauf konzentriert, Mädchen nur beizubringen, Nein zu sagen und Grenzen zu artikulieren, sondern sie ermutigt, ihre Lust zu erproben, an ihre Grenzen und die Grenzen anderer zu gehen und verführen zu lernen. Das allerdings hieße an der dominanten Ordnung und der darin eingelagerten Grammatik der Gewalt zu rütteln, daran zu zweifeln, dass männliche Sexualität eine grenzüberschreitende sei, und weibliche Sexualität die Grenze, die es zu überschreiten gelte. Johanna Schaffer fordert in diesem Zusammenhang eine umfassende Sexerziehung für Mädchen, um sie als sexuelle Subjekte (d.h. mit Sex-Willen und sexueller Entscheidungsfähigkeit ausgestattet) – nicht als Objekte – zu stärken. Angesetzt werden müsste dazu bei einer umfassenden Kritik an den Repräsentationen einer majoritären (Sex-)Moral. Es geht also um mehr als um eine Forderung nach sicheren/mehr Orten für Frauen und Mädchen. Es geht um die Produktion eigener Bilder.
Eigene Bilder und Worte den genormten entgegen zu setzen war zentrales Projekt des Workshops No Wound ever speaks for itself. Den Workshop, der auf die Praxis des Ritzens und Schneidens am eigenen Körper fokussiert, habe ich gemeinsam mit 14 Studentinnen erstmals im März 2004 an der wiener kunst schule realisiert. Hintergrund der Themenwahl war die Tatsache, dass sich immer mehr Mädchen und Frauen schneiden, um auszudrücken, wofür gesprochene Worte fehlen. Gleichzeitig wird dieses Thema in allen Formen von Öffentlichkeit tabuisiert, "bestenfalls" in Talkshows anhand "bemitleidenswerter" Einzelschicksale aufgerollt. Gesellschaftspolitische Hintergründe sowie die Frage, was die Signifizierung als Opfer bewirkt, fallen dabei unter den Tisch. Als Folge dieser Tabuisierung gibt es für so genannte "Betroffene"/"Opfer" jenseits der institutionalisierten Verwaltung als "psychisch Kranke" wenig Alternativräume. Ziel des Workshops war, einen neuen Zugang zur eigenen Sprachlosigkeit/ Sprache zu gewinnen, normativen Rollen- und Bild-Stereotypen diverse Handlungskonzepte und Bilder entgegen zu setzen, und im Austausch mit anderen selbst zur Produzentin zu werden.
Schneiden wird in diesem Kontext als Form des Selbstausdrucks, als autoaggressiver Akt, Überlebensstrategie, selbstermächtigende Handlung, autoerotischer Akt, Medium künstlerischen Ausdrucks verbalisiert, veröffentlicht und (nicht zuletzt) als Politikum zur Diskussion gestellt. Wichtig sind dennoch/also nicht die Kunst-Produkte, die im Workshop entstehen, sondern der einwöchige Prozess, in dem die Teilnehmerinnen ihre Wünsche und Forderungen in der gemeinsamen Diskussion formulieren. Wie lässt sich über Gewalt gegen Frauen angemessen sprechen, welche Bilder lassen sich produzieren? Gleichzeitig sind die Kunst-Produkte wichtig, weil es um das Öffentlich-Werden von Bildern geht, um (Selbst-)Repräsentationen eigenmächtiger nicht-männlicher Subjekte, die sich deutlich unterscheiden von den genormten Frauenbildern, die als passive Opfer und/oder Sexualobjekte den öffentlichen Raum besetzen.
Die im Rahmen des Workshops entstandenen Arbeiten wurden als Versuch einer derartigen Veröffentlichung im April 2004 im Rahmen der Ausstellung the personal is political, und peinlich in der Kunsthalle Exnergasse ausgestellt. Dabei kam mir die Doppelrolle Workshopleiterin/Co-Kuratorin in die Quere. Der Kuratorinnenblick ist ein anderer als der der Workshopleiterin, die mit den Frauen in intimem Rahmen über deren Arbeiten und Ziele diskutiert hat. Die Kuratorin greift in Arbeiten ein und wählt aus. Sie spürt die Blicke jener, die die Arbeit mit so genannten "Randgruppen" auch kritisch betrachten. Als Kunsttheoretikerin und Künstlerin sehe auch ich diese Gefahr und habe in Exponate, die die Bedeutung anderer Kunstwerke maßgeblich verändert hätten, eingegriffen, habe ausgewählt. Meine Rollen und deren teilweise Unvereinbarkeit wurden im Rahmen des Ausstellungsaufbaus diskutiert, was mit dem Vorschlag endete, das Projekt 2005 noch einmal – mit mehr Eigenverantwortung auf Seiten der Teilnehmerinnen – anzubieten.
Paradigma Nr. 3 ist also bestrebt, Sinn nicht zu schließen, sondern zu öffnen, Opferbilder zu stören und Bildproduktion zu ermöglichen, und agiert dabei auf sehr wackeligem Terrain: Im Fall von the personal is political, und peinlich implizierte das nicht nur die problematisch ambivalente Position als Workshopleiterin/Co-Kuratorin, sondern auch die Gefahr, dass ich in einem kollektiven Produktionsprozess als einzige Bilderproduzentin sichtbar bleibe. Diese Zweifel gegenüber unterschiedlichen Praxen des Sich- und Andere-Ausstellens, gegenüber voyeuristischen Betrachter- und KünstlerInnenpositionen, die Identität zuweisen und festlegen, erhalten Raum in der gemeinsam mit Alex Gerbaulet produzierten Videoinstallation Sprengt den Opfer-Täter-Komplex!. Das vierminütige Video zeigt 33mal das Brustbild eines Mannes. In jeder Einstellung stellt der Mann eine andere Frage, die gleichzeitig in großen Lettern zentral auf der Leinwand steht: "Ist der Schnitt eine Wiederholung, oder inwiefern setzt er eine Differenz zur Opferposition?", "Hast du Erfahrung damit, die Ohnmachts-Position im Rahmen von Sexualität zu reinszenieren und dadurch die Seiten zu wechseln?", "Siehst du dich beim Sprechen über deine Narben in die Opferposition versetzt, und wann nicht?" ... Daneben hängen zwei große Fotos, wobei das eine einen nackten Bauch mit waagrechten Schnitten und rundherum geritztem Rechteck zeigt, das andere eine Figur mit Pferdemaske, die (mit nackten Fingern) auf die BetrachterInnen zielt: "Ich wollte nie als Opfer diskutiert werden und sehe mich nicht als Opfer. Wenn man sich als Opfer bezeichnet, kann man sich zurückziehen und umsorgen lassen. Ich möchte mich aber nach vorne bewegen, und die Richtung bestimme ich! Mir ist mein Unbehagen und die Ambivalenz der Gefühle, die entstehen, wenn ich aggressiv und selbst zur Täterin werde, lieber. Ich ziehe den Konflikt, in dem ich meine sichere Position verlasse, der mir zugewiesenen Opferposition vor." (Gerbaulet/Pöschl 2005)
Michaela Pöschl ist Künstlerin und Kunsttheoretikerin, lebt in Wien. Die Installation Sprengt den Opfer-Täter-Komplex! ist, stumm und auf eine riesige Leinwand gebeamt, bis 4.5. 2005 als ortsspezifische Installation im ega, dem Veranstaltungsort der Wiener SPÖ-Frauen, zwischen 18 und 24 Uhr von der Straße aus zu sehen.
Literatur
Johanna Schaffer, Kinderschutzwahn? Sexerziehung! Gegen die Umcodierung des Themas "sexuelle Gewalt" in den Politiken der Rechten, in: Sex Politik, Doris Guth, Elisabeth von Samsonow (Hg.), Wien 2001
Maria Moser beendet in Kürze ihre Dissertation "Opfer-Rede. Überlegungen zu einer Ethik der Repräsentation von Ungerechtigkeits- und Gewalterfahrungen von Frauen" am Institut für Sozialethik der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien
Stella Rollig, Projekt "Frauenbrücke", in: Der Transparente Raum, Frauenbüro der Stadt Wien (Hg.), Wien 2000
Valie Export, Der Transparente Raum, ebd.
Eva Kail, Wem gehört der öffentliche Raum, ebd.