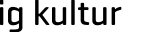Ein Jahrhundert der Kreativität? Des Kanzlers gefährliche Drohung
In der allerletzten Ausgabe der ORF-Sendung Treffpunkt Kultur verkündete Alfred Gusenbauer vollmundig, das 21. Jahrhundert sei das Jahrhundert der Kreativität. Es steht zu vermuten, dass er damit Recht behält, allerdings in einem weit unangenehmeren Sinn, als seine Begeisterung für die Kreativität es erahnen lässt.
In der allerletzten Ausgabe der ORF-Sendung Treffpunkt Kultur verkündete Alfred Gusenbauer vollmundig, das 21. Jahrhundert sei das Jahrhundert der Kreativität. Es steht zu vermuten, dass er damit Recht behält, allerdings in einem weit unangenehmeren Sinn, als seine Begeisterung für die Kreativität es erahnen lässt.
Kreativwirtschaft revisited
Schon in das im Jänner hastig formulierte Regierungsprogramm war ein eigentümlicher Begriff hineingerutscht, den im letzten Jahrzehnt hauptsächlich ÖVP-Kultursprecher und Ex-Kunststaatssekretär Franz Morak geprägt hatte: Die Kreativwirtschaft, fester Bestandteil der Reden und programmatischen Papiere Moraks, sei an der „Schnittstelle von Wirtschaft und Kultur“ besonders bedeutend. Vermutlich überhaupt das einzige, was von Moraks Kulturpolitik bleiben wird, verdankt seine Kontinuität also der bereitwilligen Auf- und Übernahme durch die SPÖ. Doch vielleicht handelte es sich dabei ja auch gar nicht um einen Zufall, einen Effekt der Eile beim Formulieren und Akkordieren des Programms der im Allgemeinen nach außen hin überhaupt nicht so einigen Koalition zwischen ÖVP und SPÖ…
Bei Franz Moraks Interventionen zur Kreativwirtschaft war es jedenfalls fast ein Jahrzehnt lang einfach um den weitgehend misslungenen Versuch gegangen, Kunst und Wirtschaft kurzzuschließen. Warum oder mit welchem Ziel, war dem Mann, der ausgezogen war, die Kreativität zu organisieren, wohl selbst nie so ganz klar. Hauptsache war die Marke, die der ÖVP zu ihrem autoritär-national-kulturalistischen Image noch den Anstrich von (Neo-)Liberalität verleihen sollte. Die kulturpolitische Implementierung des Begriffs Kreativwirtschaft in Österreich ging weitgehend schief wie fast alles in der glücklicherweise zunehmend unauffälligen Kulturpolitik Franz Moraks und Wolfgang Schüssels. Geblieben ist nicht viel mehr als das frühe Beispiel Swarovski Glas als Aushängeschild der Morakschen Kulturwirtschaftstheorie, und eine Reihe von aus anderen kulturpolitischen Geografien importierten Slogans, die in einer Nebelwand der Kreativität den Begriff vollkommen entleerten: neben der Kreativwirtschaft die „kreative Klasse“, die „kulturellen Entrepeneurs“ und die „Kreativindustrien“.
Hier lässt sich trefflich fragen, was die damit angerufenen Subjekte jemals dazu bringen könnte, sich zu kreativen Klassen oder Industrien zugehörig zu fühlen. Meine These ist ja, dass es zumindest im Kunstfeld kaum jemand geben dürfte, der oder die sich freiwillig diese Labels umhängen würde. Sehr wohl gibt es offensichtlich jedoch einen europaweiten kulturpolitischen Verschiebungsprozess, der – anfangend in Tony Blairs Politik schon der 1990er – die staatlich geförderte Kunstproduktion entpolitisieren soll: weg mit den Überresten der kulturellen Produktion als Dissens, als Widerstreit und als Schaffung von Öffentlichkeiten, her mit Kreativindustrie als möglichst reiner Funktion von Ökonomie und Staatsapparaten; von daher auch die begriffliche Bewegung kulturpolitischer Programme von demokratiepolitischen Elementen hin zu Fragen der sozialen Integration und der kreativen Industrie, inklusive der Fetischisierung der Mobilität ihrer Subjekte und Objekte. Gleichzeitig werden in benachbarten Politikbereichen ebenfalls Creative Classes und Creative Cities an- und aufgerufen, Kreativität wird durch ihren derzeit bekanntesten Propagandisten Richard Florida und seine AnhängerInnen in Politik und Verwaltung vor allem zum Instrument der Standortpolitik.
Für das kulturelle Feld, seine Institutionen und AkteurInnen waren und sind das natürlich in erster Linie problematische Übergriffe, die allerdings in konkreten Fällen auch immer wieder gekontert werden konnten – wie sich im Widerstand gegen den Morak’schen Übernahmeversuch der damals kurzzeitig politisierten Diagonale (diese Politisierung gehört allerdings heute schon wieder der Vergangenheit an) ebenso zeigte wie in jenem der französischen Intermittents, die sich seit 2003 gegen die Verschärfung des Sozialversicherungsrechts in Frankreich zur Wehr setzen.
Die (Selbst-)Verpflichtung zur Kreativität
Aber das Gefährliche an Alfred Gusenbauers Emphase für die Kreativität betrifft gar nicht so sehr den Kulturbereich, des Kanzlers kulturpolitische Begehrlichkeiten dürften sich auf die Besetzung von Posten in Staatsoper etc. beschränken. Gefährlicher stellt sich die Rede vom „Jahrhundert der Kreativität“ über das kulturelle Feld hinausgehend als Symptom einer gesellschaftlichen Transformation größeren Ausmaßes dar.
Und hier sind gewisse programmatische Linien der Sozialdemokratie wesentlich einflussreicher als die platten, mit wenig ideologischer Verve und Überzeugung ausgeführten Interventionsversuche von Morak und Konsorten. Emanzipatorische sozialdemokratische Programme der 1970er, die eigentlich auf revolutionäre Konzepte aus den 1920ern zurückgehen, schrieben sich Slogans wie „Kultur für alle“ und „Kultur von allen“ auf die Fahnen. Diese groß angelegten Ansätze einer „Demokratisierung der Kultur“ sollten nicht nur den Zugang der ArbeiterInnen zum bürgerlichen Kulturkonsum ermöglichen, sondern dem Götzendienst hehrer Kunst eine säkularisierte Kulturproduktion entgegenstellen – so zumindest die Zielvorstellungen mehrerer Generationen sozialistischer und sozialdemokratischer Kulturpolitik des 20. Jahrhunderts. Die Realisierung dieser Konzepte wurde aus ganz unterschiedlichen Gründen nie im Sinne ihrer ErfinderInnen durchgesetzt, und mit den „allen“, die Kultur nun konsumieren und produzieren sollten, waren auch nie wirklich alle gemeint – der nationale Rahmen produziert(e) verlässlich seine Ausschlüsse mit.
Doch zur allgemeinen Überraschung scheinen sich die kulturpolitischen Konzepte der 1970er nun, im Laufe des jahrzehntelangen Prozesses der Entwicklung von postfordistischen Kontrollgesellschaften, doch einer Verwirklichung anzunähern, wenn auch völlig ihrer ursprünglichen politischen Intention beraubt und pervertiert. Wurden Kultur und Kreativität früher gerade als Außen von Arbeit und Verwertungszusammenhängen begriffen, so verschwimmen diese Bereiche zusehends. Wie Paolo Virno, Maurizio Lazzarato und andere postoperaistische TheoretikerInnen schon seit den frühen 1990ern ausgeführt haben, ist der Postfordismus durch die ihm zugrunde liegende räumlich-zeitliche Homogenität geprägt, in der – zumindest, was die Frage von Produktivität und Kreativität betrifft – der Zeit/Raum der Arbeit von jenem der Nicht-Arbeit ununterscheidbar wird. Eine Reihe von positiv konnotierten Begrifflichkeiten wie Kommunikation, Kooperation, Kollektivität, etc. werden hier zu Funktionen einer neuen Form kapitalistischen Kommandos, Virno nennt das gern den „Kommunismus des Kapitals“. Was 1968 noch ein Ziel emanzipatorischer Politik war, bedeutet 40 Jahre später eine gefährliche Drohung, auch und vor allem im weichen begrifflichen Territorium zwischen Kultur und Kreativität. „Kultur für alle“, hierzulande zuletzt Slogan für ein Wiener Tourismus- und Kulturverwertungsgelände namens Museumsquartier, heißt heute Zwang zur populistisch-spektakulären Forcierung von Quantität und Marketing, und „Kultur von allen“ weist in seiner pervertierten Form hin auf eine allumfassende (Selbst-)Verpflichtung zur Kreativität.
Universalisierung des „kreativen Imperativs“
Denn der „kreative Imperativ“ wird nicht nur von Regierungsmitgliedern ausgerufen, von Kunstkanzlern, Sekretären und Ministerinnen, die die ihnen Anempfohlenen zu neuen genialen künstlerischen Höchstleistungen anspornen. Kreativitätsnachfragen sprießen auch in Stellenanzeigen und Personalseminaren, im täglichen Arbeitsalltag nicht nur von Intellektuellen, Chefs und jenen Agenturmenschen, die man früher mal „Kreative“ hieß. Jobs für alle möglichen Dienstleistungen verlangen heute ebenso nach Kreativität wie solche auf jeglicher Managementebene. Und: im kreativen Imperativ regieren sich die Subjekte einfacher Weise auch noch selbst. Konzerne und Staatsapparate bedürfen nicht mehr nur der Repression, um Kreativität und Kooperation, Sozialität und Kommunikation grenzenlos produktiv und nutzbar zu machen. Und es braucht auch gar keinen paradoxen Kreativitätsbefehl, es reicht die bloße Anrufung: Seid kreativ! – und die kreativen Schafe freuen sich, sofern sie nicht gerade vor lauter Druck, Angst und Existenzsorgen kreativitätsunfähig sind. Um ein Wort von Gilles Deleuze zum Begriff des „lebenslangen Lernens“ abzuwandeln: Kreativität wird zu einem schrecklichen permanenten Zwang, einer kontinuierlichen Kontrolle, der sich alle lebenslang unterwerfen, in einem Amalgam aus selbstgewählter und fremdbestimmter Prekarisierung. Jeder Mensch ein Künstler, dementsprechend flexibel, spontan und mobil oder selbstausbeuterisch, unabgesichert und vogelfrei soll er/sie auch arbeiten und leben.
Des Kanzlers gefährlicher Drohung wären in einem solchen Setting, in einem solchen Jahrhundert der Kreativität, in dem Kultur für und von allen gemacht wird, vielleicht andere Visionen entgegenzusetzen: das 21. Jahrhundert als Jahrhundert einer Kunst, die das Unproduktive ebenso schätzt wie die Unterbrechung der viel zu gut geölten Flüsse der Kreativität. Eine solche Kunst würde ihre Spielräume nicht nur im kulturellen Feld eröffnen, sondern gegen die Instrumentalisierung der Kreativität und die Prekarisierung in allen Arbeits- und Lebensbereichen mit allen möglichen Mitteln ankämpfen: mit kleinen Akten der Verweigerung, mit Missmutigkeit wie Humor, mit mikropolitischen Interventionen, Sabotage der Informationsflüsse, Kommunikationsguerilla, aber auch im Rahmen von gewerkschaftlichen Erneuerungsbemühungen oder immer neuer sozialer Bewegungen, nicht zuletzt zur Wiederaneignung der Kreativität.
Literatur
Deleuze, Gilles (1993): „Kontrolle und Werden“. In: Ders.: Unterhandlungen. Frankfurt/M., S. 243-253
Lazzarato, Maurizio (1998): „Immaterielle Arbeit“. In: Negri, Toni / Maurizio Lazzarato / Paolo Virno: Umherschweifende Produzenten. Berlin, S. 39-52
Raunig, Gerald / Wuggenig, Ulf (Hg.) (2007): Kritik der Kreativität. Wien
Virno, Paolo (2005): Grammatik der Multitude. Wien
Gerald Raunig ist Philosoph und arbeitet am European Institute for Progressive Cultural Policies (eipcp) in Wien.
Mit Dank für guten Rat von Ljubomir Bratić und Dominik Kamalzadeh.