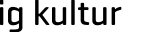(Des)Illusion von Unabhängikeit
Dem Kampf gegen ökonomische Ungleichheiten muss die Anerkennung der Tatsache vorausgehen, dass im Kunstfeld und zwischen den KünstlerInnen Klassenunterschiede existieren.

Vesna Vuković
(Des)Illusion von Unabhängigkeit
Ausgehend von der Annahme, dass die künstlerische Arbeit innerhalb der kapitalistischen Ökonomie gewissermaßen einen Ausnahmestatus hat, setzt sich dieser Beitrag mit den Arbeitsbedingungen im Kunstfeld auseinander und legt ein besonderes Augenmerk auf die in jüngster Vergangenheit stetig zugenommene Mobilisierung von AktivistInnen in Kunst und Kultur, die verstärkt für ihre Anliegen einstehen.[i] Der konstatierte Ausnahmestatus bezieht sich sowohl auf den Charakter der künstlerischen Tätigkeit (d.h. ihre Position in den Produktionsverhältnissen), als auch auf ihre Reproduktion. Trotz der feldspezifischen Schwierigkeiten kann dabei die Klassenanalyse nicht außer Acht gelassen werden, da sie für das Verständnis von kapitalistischen Gesellschaften wesentlich ist und dazu beiträgt, konzeptuellen Raum für politisches Handeln zu schaffen.
Ihr Kampf bleibt deshalb ein großer Kampf für die eigenen professionellen Interessen; sich mit anderen gesellschaftlichen Gruppen zu solidarisieren und zu vernetzen, wird verabsäumt.
Spätestens seit der letzten kapitalistischen Krise ist ein wachsendes Interesse an den Arbeitsbedingungen im Kunstfeld beobachtbar. Die in der Kunst (bzw. im weiteren Sinne: in der Kultur) Tätigen definieren sich in den vergangenen Jahren immer häufiger als art workers (KunstarbeiterInnen) und cultural workers (KulturarbeiterInnen) und organisieren sich in Plattformen, die gegen schlechte Arbeitsbedingungen im Kunstfeld, aber auch gegen soziökonomische Benachteiligungen ihres Berufsstandes im Allgemeinen protestieren.
Diese Entwicklung bedeutet jedoch noch nicht, dass AkteurInnen im Kunstfeld nun für systemische Kritik sensibilisiert sind. Obwohl all den Initiativen gemein ist, dass sie die sozioökonomische Ungleichheit im Kunstfeld eindeutig als solche identifizieren, versuchen sie diese im Rahmen des Kunstfeldes selbst zu erklären – und sie konsequenterweise auch darin zu beseitigen, ohne dabei in einem breiteren Kontext zu argumentieren und zu agieren. Ihr Kampf bleibt deshalb ein bloßer Kampf für die eigenen professionellen Interessen; sich mit anderen gesellschaftlichen Gruppen zu solidarisieren und zu vernetzten, wird verabsäumt.
Ein konzeptueller Terminus, der für eine Vielzahl an Gruppen anwendbar ist, ist der der Prekarität. Kennzeichnend für den soziologischen Begriff ist eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Unsicherheit, die sich auf die Erwerbstätigkeit von Mitgliedern verschiedener sozialer Gruppen bezieht. Die schon lange im Sprachgebrauch befindliche Prekarität kommt vom Adjektiv prekär, das im ursprünglichen Sinne „unsicher, weil widerruflich“ meint, und kennt auch die aus Proletariat und prekär zusammengeführte Abwandlung Prekariat (meines Erachtens eine redundante Wortkreation, da das Proletariat per definitionem prekär ist). Die Prekarität im heutigen Sinne hat ihren Ursprung in der postindustriellen Gesellschaft, die im starken Gegensatz zur industriellen Gesellschaft und ihrer Arbeitsorganisation und -teilung steht. Nach Karl Marx (1818–1883) sind für letztere Gesellschaftsform „industrielle Reservearmeen“ charakteristisch – ein Umstand, der den Erwerbstätigen das Gefühl der Ersetzbarkeit und permanenten Bedrohung bringt. Das Proletariat hat Marx als eine von Prekarität gekennzeichnete Klasse beschrieben. Proletarier könnten nur dadurch überleben, indem sie ihre eigene Arbeitskraft verkaufen. Die Prekarität ist also definierendes Merkmal proletarischer Existenz sowie gleichermaßen entscheidendes Element des proletarischen Kampfes.
Nach der jahrelangen unkritischen Betrachtung und bisweilen sogar Glorifizierung von sogenannten Freelancern scheint die begriffliche Durchsetzung der Prekarität schon beinahe ein Fortschritt zu sein, jedoch ist sie ebenfalls problematisch.
Das Konzept der Prekarität wird gegenwärtig reduktionistisch und ahistorisch behandelt. Reduktionistisch, weil es jene Gruppierungen akzentuiert, die aufgrund ihrer Lebensumstände sozial abgestiegen sind bzw. von einem sozialen Abstieg bedroht sind, jedoch weder die Strukturlage der Arbeiterklasse ins Blickfeld nimmt, noch die Unterschiede zu Kapitalisten und anderen Klassen hervorstreicht.
Als Folge stehen diese Gruppierungen im Gegensatz (oder im Widerspruch) zu jenen ProletarierInnen, die angestellt sind. Zur Verdeutlichung seien Museen und Galerien angeführt, in welchen zeitgenössische KünstlerInnen gegen Benachteiligungen protestieren, aber keine Beziehungen zu den Angestellten (dem sog. nicht kreativen, heutzutage häufig nicht festangestellten Personal aus den Bereichen Technik, Reinigung etc.) knüpfen. Gekämpft wird hier für De-Proletarisierung, aber nicht für eine proletarische Vereinigung. Der Protest ist individualistisch und auf die engen professionellen Anliegen und Interessen der Mittelklasse gerichtet.
Darüber hinaus wird das Konzept der Prekarität auch auf eine ahistorische Weise behandelt: Die VertreterInnen der Prekaritätstheorie betrachten den Zeitraum nach dem Zweiten Weltkrieg (die sog. „Goldene Zeit“ oder die Zeit des Sozialstaats, auf jeden Fall der Zeitraum, der eine Ausnahme im Kapitalismus darstellt) als Ausgangspunkt und als naturgegebene Lage. Dabei wird der historische Kontext weithin außer Acht gelassen – sowohl was die zum Teil blutige Vorgeschichte des relativen Friedens zwischen Kapital und Arbeitskräften betrifft, als auch was den gegenwärtigen Sozialstaat betrifft. Dessen Entstehung geht auf die Zeit des Kalten Krieges zurück, als Gewerkschaften und kommunistische Parteien auch im Westen an Bedeutung gewonnen haben. Um zu verstehen, wie es zu diesem kurzen Abkommen zwischen dem Kapital und den Arbeitskräften gekommen ist, muss auf das grundlegende Marx’sche Konzept, das die Prekarität als definierendes Merkmal der Arbeiterklasse begreift, zurückgegriffen werden. Ferner dient es als Analyseinstrument für das Aufkommen des heute als Neoliberalismus bekannten Klassenkrieges, der infolge der ersten kapitalistischen Krise nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1970er Jahren – durch Budgetkürzungen und Angriffe auf Gewerkschaften – begonnen hat.
Die eingangs angeführte Feststellung,
dass die Kunst, oder genauer die künstlerische Arbeit, einen exzeptionellen Status in der kapitalistischen Ökonomie hat, lässt sich u.a. daran festmachen, dass sie im starken Gegensatz zur Lohnarbeit steht. KünstlerInnen erhalten keinen Werklohn als Entlohnung für ihre Rolle in der Warenproduktion, sondern verkaufen ihr Produkt (z.B. an die Galerie oder an die SammlerInnen). Einerseits haben sie Kontrolle über den Arbeitsprozess und verfügen über Produktionsmittel, andererseits aber profitieren sie nicht davon, weil sie keine Überschüsse anhäufen können.
Der exzeptionelle Status der künstlerischen Arbeit in der kapitalistischen Ökonomie reproduziert das Ideal, das Wunschbild der Mittelklasse: frei sein, d.h. Kontrolle über den eigenen Arbeitsprozess haben und sich mit der eigenen Arbeit identifizieren zu können. In diesem Sinne ist die künstlerische Arbeit von ihrem Charakter her eine Mittelklassearbeitsform, wobei freilich auch viele gemischte Arbeitsformen existieren.
Unabhängig davon, wie die konkrete soziale Position der individuellen KünstlerInnen ist, ist ihre Arbeit an die Mittelklasse angebunden. Hier kommen wir zum zentralen Problem mit der Klasse im Kunstfeld: Die Klassenunterschiede sind darin nicht anerkannt. Allen KunstarbeiterInnen und KulturarbeiterInnen ist gemein, dass sie kreativ sind, unabhängig sind, dass sie Kunst machen. Dies sollte ihr einziges Interesse sein, jenseits von Klassenunterschieden, die das Kunstfeld – wie die Gesellschaft im Allgemeinen – durchkreuzen. Dem Kampf gegen ökonomische Ungleichheiten muss die Anerkennung der Tatsache vorausgehen, dass im Kunstfeld und zwischen den KünstlerInnen Klassenunterschiede existieren. Um das gegenwärtige Ideal der Mittelklasse, sich mit der eigenen Arbeit zu identifizieren, zu erreichen oder diesem zumindest näher zu kommen, ist ein immer größeres Maß an Arbeit notwendig, was wiederum zu einem höheren Maß an Ausbeutung führt.
Kunst ist – besonders was die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts betrifft – ein Instrument der sozialen Mobilität. Eine der höchsten Stufen des sozialen Aufstiegs ist der Besitz von Kunstwerken. Während also der Besitz von Kunstwerken auf einen hohen sozialen Status schließen lässt, geht die Produktion von Kunstwerken mit einem niedrigen einher. Dieser Widerspruch verdeutlicht den doppelseitigen Wert der Kunst: Künstlerische Arbeit ist eine Mittelklasseform der Arbeit, und obgleich proletarisiert, dient sie den Interessen der herrschenden Klasse, die sich durch den Kunstbesitz definiert.
Die auf die Vervielfältigung der kreativen Berufe und der wachsenden Absorption von Kunst in Kapitalprozesse zurückzuführenden geänderten Arbeitsverhältnisse im Kunstfeld können hier nicht im Detail analysiert werden. Was jedoch festgestellt werden kann, ist, dass die Anerkennung der eigenen (prekären) Arbeitsbedingungen mit der Anerkennung der brutalen Realität des Kapitalismus einhergeht. Statt die Proletarisierung im Kunstfeld isoliert zu betrachten und zu bekämpfen, muss der Kampf erweitert werden – in erster Linie dahingehend, sich mit der Arbeiterklasse zu solidarisieren und zu vernetzen. Unabhängig davon, in welchem Ausmaß sich KunstarbeiterInnen und KulturarbeiterInnen als ArbeiterInnen definieren, erkennt die Arbeiterklasse sie nicht als ArbeiterInnen an (selbst wenn sie direkt im Kunstfeld tätig sind, etwa als nicht kreative ArbeiterInnen in Museen und Galerien, als anonyme HerstellerInnen von Kunstkomponenten etc.). Wenn dann noch die soziale Rolle der Kunst berücksichtigt wird und gefragt wird, für wen diese Arbeit gemacht ist – wer arbeitet, wer hat Zugang dazu, wer profitiert – verändert sich der Blick darauf.
Die Kunst ist keineswegs ein Bereich von freischwebenden Ideen, sondern eine Form von Praxis, die durch den außergewöhnlichen sozioökonomischen Status von KünstlerInnen, wie auch durch gesellschaftliche Beziehungen, die diesen Status bestimmen, bedingt ist.
Vesna Vuković ist Kuratorin, Wissenschafterin und Übersetzerin. Sie war Lehrbeauftragte in Zagreb und Split und ist Radiomacherin beim kroatischen Radio 3.
[i] Der Text basiert auf dem am 25. November 2016 in Graz gehaltenen gleichnamigen Vortrag im Rahmen des Symposiums „Matryoshka Effect – Cultural Policies and its Ideologies. Zur Lage von Kunst und Kultur in zeitgenössischen kapitalistischen Gesellschaften“.