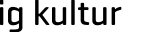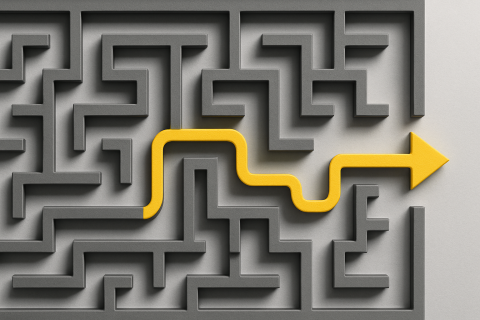„Demokratieministerium“ – so nennt Andreas Babler das von ihm geleitete Ressort für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, denn, „Demokratie braucht Öffentlichkeit, kulturelle Verständigung, Teilhabe und gemeinsame Erlebnisse.“ Und tatsächlich liest sich das kulturpolitische Selbstverständnis der neuen Bundesregierung wie ein Bekenntnis zur Teilhabe: flächendeckende kulturelle Nahversorgung, Ausbau kultureller Bildung, faire Bezahlung als Ausdruck des Respekts gegenüber Künstler:innen und Kulturarbeiter:innen. Worte, die eine klare Richtung vorgeben – und die, wenn eins sie ernst nimmt, nichts weniger als eine radikale Umverteilung kultureller Ressourcen bedeuten würden. Doch nach den ersten 100 Tagen im Amt zeigt sich: Die Wirklichkeit ist (noch) eine andere. Und sie hat einen Preis – in Zahlen, Strukturen und Biografien.
Der Rotstift des soeben beschlossenen Sparpakets 2025/26 macht auch vor dem Kunst- und Kulturbudget nicht halt. Zwar steigt das Budget 2025 für Kunst und Kultur insgesamt noch leicht an, diese vorläufige Steigerung ergibt sich jedoch im Wesentlichen aus der Wertanpassung der Fördermittel für Bundestheater und Bundesmuseen. Gleichzeitig werden Investitionen in Bau- und Infrastrukturmaßnahmen bei diesen Institutionen verschoben oder können vorübergehend aus deren Rücklagen vor- bzw. zwischenfinanziert werden. Für 2026 ist hingegen ein spürbarer Rückgang des Kulturbudgets insgesamt vorgesehen: um fast 40 Millionen Euro. Laut Kulturminister Andreas Babler konnte dennoch ein „Kahlschlag verhindert“ werden, da „politisch gewichtet wurde“ im Wissen, „wie wichtig regionale Kulturarbeit auch im ländlichen Raum ist, wie wichtig kreative Bildung und kulturelle Nahversorgung für unsere Gesellschaft sind“.
Bedeutsam ist, wo gekürzt wird. Die Filmbranche verliert 22 Millionen Euro – vor allem durch Einschnitte bei der Förderstruktur ÖFI+, dem zentralen Finanzierungsmodell für österreichische Kinofilme. Weitere 11 Millionen Euro werden bei der frei vergebenen Kunst- und Kulturförderung gestrichen – also bei jener Förderung, die die freie Szene quer durch alle Sparten betrifft, und das bereits ab 2025. Was budgetär gering wirkt und sich bürokratisch als Kürzung bei „Transferzahlungen“ tarnt, ist in Wirklichkeit ein unmittelbarer Rückbau jenes Fundaments des Kunst- und Kulturlebens, das ohnehin von prekären Arbeitsverhältnissen getragen wird: Kulturvereine, Festivals, freie Theatergruppen, Literaturinitiativen, Künstler*innen – all jene, die auf kleinteilige Förderungen angewiesen sind und meist projektbasiert, unterbezahlt oder ehrenamtlich arbeiten, aber dennoch Infrastrukturkosten für Räume, Technik und Logistik tragen müssen. Diese Kürzungen treffen also genau jenes Netzwerk, das die versprochene kulturelle Nahversorgung überhaupt erst ermöglicht.
Zur Einordnung: Die Höhe der Kürzungen in der freien Szene übersteigt die jährlichen vergebenen Bundesmittel für Kulturinitiativen; die jährlichen Förderungen für alle Projekte und Jahresprogramme in der Sparte Musik; oder für sämtliche Stipendien und Projekte in der bildenden Kunst (siehe Analyse des Kulturrats). Gemessen am Bundesbudget handelt es sich um 0,008 Prozent der Gesamtausgaben. Die Kürzungen stehen damit in direktem Widerspruch zum Regierungsprogramm – und sie wirken umso gravierender, da auch Länder und Gemeinden ihre Kulturförderungen zurückfahren. Was bleibt, ist ein Flickwerk an Ankündigungen – und eine Realität, die bestehende Strukturen gefährdet, bevor sich neue überhaupt etablieren können. Von Wertanpassungen in der Entlohnung künstlerischer und kultureller Arbeit in Richtung fairer Bezahlung für berufliche Tätigkeit ganz zu Schweigen.
Besonders drastisch wird die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit dort, wo kulturpolitische Rhetorik auf sozialpolitische Realität trifft: Mit dem Budgetbegleitgesetz wurde auch die Möglichkeit eines geringfügigen Zuverdienstes zum Arbeitslosengeld abgeschafft. Was als arbeitsmarktpolitisches Signal verkauft wird, ignoriert die Lebensrealität im Kunst- und Kulturbereich. Denn dort gehören kurzfristige Tätigkeiten – ein Lesungshonorar, ein Drehtag, eine Übersetzung – nicht nur zur ökonomischen Notwendigkeit, sondern zur beruflichen Praxis, um in einem projektbasierten Sektor auch in Zeiten der Arbeitssuche präsent zu bleiben. Seitens der SPÖ will man das Gesetz, bevor es ab 1.1.2026 in Kraft tritt, noch reparieren um die Erwerbsrealitäten von Künstler:innen zu berücksichtigen – die Zustimmung der Koalitionspartner vorausgesetzt. Das ist dringend geboten, denn ohne diese Zuverdienstmöglichkeit wird kulturelle Arbeit für viele nicht nur existenziell riskanter, sondern zunehmend unmöglich – insbesondere für jene, die nicht über private Rücklagen, familiäre Unterstützung oder institutionelle Anbindungen verfügen. Was hier entsteht, ist nicht bloß eine neue Armutsfalle, sondern ein struktureller Ausschlussmechanismus: Wer sich Kulturarbeit nicht leisten kann, bleibt außen vor.
Diese Dynamik ist nicht neu, aber sie verschärft sich. Und sie ist demokratiepolitisch relevant – nicht trotz, sondern gerade wegen der Erzählung vom Demokratieministerium. Denn wenn das Ziel ein breit getragenes, vielfältiges, lokal verankertes Kulturangebot ist – eines, dass keine Elitenveranstaltung bleibt, sondern unterschiedliche Stimmen und Perspektiven sichtbar macht –, dann braucht es mehr als schöne Worte: Es braucht reale, verlässliche Rahmenbedingungen, unter denen alle in Kunst und Kultur Engagierten unter würdigen Bedingungen arbeiten können. Eine Politik, die mit dem Versprechen kultureller Teilhabe auftritt, aber strukturell gerade dort kürzt, wo diese Teilhabe praktisch verwirklicht wird, riskiert ihre Glaubwürdigkeit.
Zugutehalten muss eins: Die Regierung ist erst 100 Tage im Amt. Und die Ausgangslage war keine leichte – finanziell angespannt, strukturell kulturpolitisch über Jahrzehnte anders ausgerichtet. Dennoch: Wo gekürzt wird, „auch in Zeiten harter Einsparungen“, ist eine politische Entscheidung, selbst wenn es im Bereich der sogenannten „Ermessensausgaben“ bürokratisch leichter und budgetwirksam schneller umsetzbar ist. Umso mehr Bedeutung hat, welche Maßnahmen die Regierung flankierend setzt bzw. vorbereitet. „Die budgetären Spielräume mögen beschränkter sein, das gilt aber nicht für den politischen Handlungsspielraum zur Unterstützung von Kunst und Kultur in Österreich“, wie Staatssekretärin Michaela Schnmidt bei der Budgetdebatte im Nationalrat stellvertretend für Kulturminister Andreas Babler festhielt. Nur: Konkrete Maßnahmen, wie die programmatischen Ziele erreicht werden sollen, fehlen bislang. Je länger sie ausbleiben, desto mehr werden aus großen Versprechen reale Lücken – in Biografien, in Regionen, in der kulturellen Öffentlichkeit.
Wer Kulturpolitik als demokratiepolitische Infrastruktur ernst nimmt, muss sich an Taten messen lassen – und an den Ressourcen, die dafür aufgewendet werden. Alles andere bleibt eine schöne Erzählung, mit schwerwiegenden Folgen. Kultur ist kein Bonus, sondern demokratische Infrastruktur.
Dieser Artikel erschien zuerst, in leicht gekürzter Form, unter dem Titel "Kultur muss leistbar bleiben" in der Straßenzeitung AUGUSTIN, Ausgabe 624.
Angekündigte kulturpolitische Arbeitsschwerpunkte der Bundesregierung*:
Flächendeckende kulturelle Nahversorgung
…. wird als „ein besonderer Schwerpunkt der Regierungsarbeit“ definiert. Ziel sei die Stärkung der kulturellen Infrastruktur durch bessere Rahmenbedingungen, beispielsweise Möglichkeiten, um Leerstände in Gemeinden für Kunst und Kultur zu nutzen.
Weiterentwicklung der Strategie für Fair Pay
…faire Bezahlung und bessere soziale Absicherung für Künstler:innen und Kulturarbeiter:innen durch Berücksichtigung der Erwerbsrealitäten dieser Gruppe, im Rahmen einer Interministeriellen Arbeitsgruppe die eingerichtet wird. Die für Fair Pay zweckgewidmeten Fördermittel werden 2025 jedenfalls in gleicher Höhe wie 2024 fortgeschrieben.
Kulturelle Bildung
… durch niederschwellige kulturelle Teilhabe, die bereits in der Kindheit möglich sein soll. In Abstimmung mit dem Bildungsministerium soll die Kooperation von Regelschulen mit Musikschulen gestärkt und die Weiterentwicklung von Musikschulen zu breiter angelegten Kunstschulen forciert werden.
Gedenkkultur
…durch bessere Koordinierung der Veranstaltungen zur öffentlichen Auseinandersetzung mit der Geschichte Österreich, konkret durch Einrichtung einer Koordinierungsstelle für Gedenkfeiern und Jubiläen
Film- und Musikwirtschaft
… Prüfung der Möglichkeiten zur Umsetzung einer Investmentverpflichtung sowie einer Streamingabgabe; Spezifisch zur Filmförderung ÖFI plus (jener Förderung, die im Jahr 2025 bereits am 15. Jänner ausgegeben war), „stärker selektiv und damit auch treffsicherer“ ausgerichtete Fördervergabe, u.a. zu erarbeiten im Rahmen einer Arbeitsgruppe.
Baukultur
… mit potenziellen Synergien mit dem Bereich Wohnen, etwa bei der Umsetzung der baukulturellen Leitlinien des Bundes zur Belebung von Stadt- und Ortskernen.
*Quellen:
Kulturbudgetdebatte im Nationalrat, 18.06.2025
Kulturausschuss, 26.06.2025
www.bmwkms.gv.at