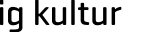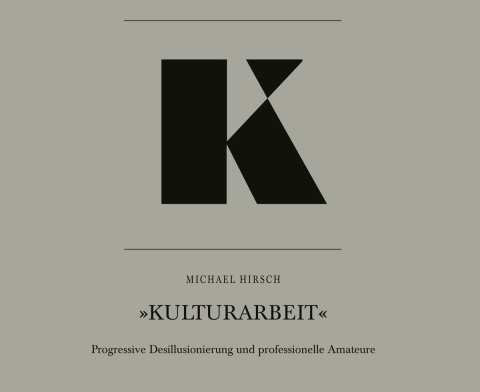13 April 2023 /
Theorie /
Zehra Baraçkılıç

Aktuell spiegelt sich die Realität einer diversen Gesellschaft in der dominierenden Kunst- und Kulturlandschaft Österreichs nach wie vor kaum bzw. nicht ausreichend wider. Um dies langfristig zu ändern, muss Bewusstseinsschaffung dahingehend ein essenzieller und fixer Bestandteil von Kunst- und Kulturbildung werden. Dass Stimmen aktiv verdrängt werden, Unterdrückungssysteme in allen Lebensbereichen wirken und weiße Privilegien in der Bildung und in der weitreichenden Wissensvermittlung dominieren, muss anerkannt, kritisch betrachtet und aktiv angegangen werden, um eine faire Verteilung von Ressourcen zu ermöglichen. Prioritär ist dabei, dominante Erzählungen zu dezentralisieren und den nachkommenden Generationen Bilder zu vermitteln, die der Realität entsprechen, um tatsächlich allen und nicht nur manchen jungen Menschen gleichberechtigte Startbedingungen zu ermöglichen.